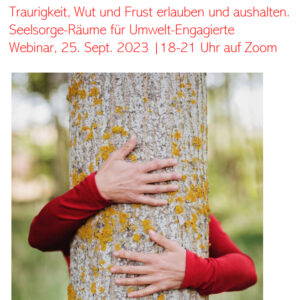von FJ Klausdeinken

Erzbischof Udo Markus Bentz aus Paderborn hat mit entschiedenem Engagement bewiesen, welche Rolle die Kirche in humanitären Krisensituationen spielen kann – nicht nur durch Hilfsleistungen, sondern auch durch das Einmischen in öffentliche Debatten und das Einfordern moralischer Verantwortung. Sein Einsatz für die Menschen im Gazastreifen ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie Kirche und Glaube konkret wirksam sein können.
Hilfe konkret: Finanzielle Mittel und praktischer Einsatz
Aus dem Katastrophenfonds des Erzbistums Paderborn hat Bentz zusammen mit der kirchlichen Gemeinschaft 500.000 Euro für humanitäre Hilfe in Gaza bereitgestellt.
- 250.000 Euro gingen an Malteser International für den Aufbau und die Vorbereitung eines mobilen Krankenhauses.
- Die anderen 250.000 Euro wurden für Hilfsgütertransporte zur Verfügung gestellt, die zusammen mit Caritas international organisiert werden.
Diese Mittel sind nicht nur symbolisch: sie ermöglichen Vorbereitungen – etwa für Medikamente, Material, Logistik –, damit Hilfe möglichst unmittelbar dort wirkt, wo sie dringend gebraucht wird.
Kritik und Mahnungen: Stimme der Moral und des Völkerrechts
Neben der materiellen Hilfe erhebt Erzbischof Bentz deutliche Forderungen:
- Er kritisiert das militärische Vorgehen Israels und nennt die massiven zivilen Opfer „nicht mehr verhältnismäßig“.
- Er betont, dass Solidarität allein nicht ausreiche: humanitäre Hilfe müsse ohne Verzögerung möglich sein. „Jede Stunde, die wir warten müssen, kostet Menschenleben.“
- Er räumt ein: Kritik an politischem Handeln sei nicht automatisch antisemitisch. Freundschaft zu Israel schließe die Pflicht zur Wahrheit und zur Wahrung des Völkerrechts mit ein.
Damit nimmt Bentz eine wichtige Rolle ein: Er richtet den Blick nicht allein auf die Opfer, sondern auch auf jene, die politisches Gestalten und Verantworten innehaben – bei der Frage, wie in Konflikten Menschenrechte, internationales Recht und humanitäre Prinzipien eingehalten werden.
„Verachtung und Hass lassen sich nicht durch Unterdrückung überwinden. Frieden im Nahen Osten ist nur möglich, wenn sich Israelis und Palästinenser gegenseitig das Existenzrecht zugestehen. Über zwei Millionen Menschen den Zugang zu humanitärer Hilfe zu verweigern, ist selbst im Krieg kein legitimer Akt.“ (Erzbischof Bentz)
Bentz betont, dass Kritik an der israelischen Kriegsführung nicht gleichzusetzen sei mit antisemitischen Ressentiments. Vielmehr sei es Ausdruck von echter Freundschaft zu Israel, Fehlentwicklungen klar zu benennen – gerade dann, wenn die Regierung internationales Recht missachte und sich zunehmend isoliere. Für Bentz ist es eine moralische Pflicht, auf solches Unrecht hinzuweisen:
„Das hat nichts mit Antisemitismus zu tun, sondern mit Verantwortung gegenüber den Menschenrechten.“ (Erzbischof Bentz)
Das Engagement von Erzbischof Udo Markus Bentz könnte auf mehreren Ebenen Wirkung entfalten – kurzfristig wie langfristig:
1. Unmittelbare humanitäre Wirkung
- Finanzielle Hilfe: Mit den bereitgestellten 500.000 Euro werden Soforthilfen ermöglicht – etwa Medikamente, Nahrungsmittel und die Vorbereitung mobiler Kliniken. Das rettet akut Leben.
- Signalwirkung für andere Spender: Wenn ein großes Erzbistum vorangeht, erhöht das den Druck auf andere Institutionen, ebenfalls zu helfen – sei es andere Bistümer, Hilfswerke oder auch staatliche Akteure.
2. Politische Wirkung
- Erhöhung des Handlungsdrucks: Durch seine klaren Worte zur Verhältnismäßigkeit der Gewalt und zur Dringlichkeit humanitärer Korridore verschärft Bentz den öffentlichen Druck auf Politik und internationale Akteure.
- Kritik ohne Antisemitismus: Er schafft Raum für eine differenzierte Debatte, die Kritik am israelischen Vorgehen erlaubt, ohne in Feindbilder abzugleiten. Das ist wichtig, um in Deutschland eine sachliche Diskussion über Völkerrecht, Menschenrechte und Sicherheit zu ermöglichen.
- Stärkung humanitärer Prinzipien: Seine Stimme macht deutlich, dass es universale Maßstäbe gibt – die Würde des Menschen, das humanitäre Völkerrecht –, die nicht relativiert werden dürfen.
3. Gesellschaftliche Wirkung
- Öffentliche Sensibilisierung: Viele Menschen, die von der Situation in Gaza nur am Rande hören, werden durch die klare Positionierung der Kirche stärker auf das Leid aufmerksam.
- Ermutigung für zivilgesellschaftliches Engagement: Ehrenamtliche, Hilfswerke und private Spender fühlen sich bestärkt, ebenfalls aktiv zu werden.
- Orientierung für Gläubige: Für Christinnen und Christen gibt Bentz eine klare Richtung: Glaube ist nicht nur privat, sondern hat Konsequenzen für Solidarität und gesellschaftliches Handeln.
4. Kirchliche Wirkung
- Profilierung der Kirche als moralische Instanz: In Zeiten, in denen viele Menschen die Kirche kritisch sehen, zeigt sich hier ihre Stärke – als Anwältin der Schwachen.
- Impuls zur Selbstverpflichtung: Das Engagement kann innerhalb der katholischen Kirche neue Initiativen auslösen, etwa verstärkte Kooperation mit internationalen Hilfsorganisationen oder eigene Friedensinitiativen.
- Signal in die Weltkirche: Solche Stimmen aus Deutschland können international wahrgenommen werden, etwa im Vatikan oder in ökumenischen Netzwerken, und dort Debatten anstoßen.
Der Erzbischof von Paderborn macht mehr als nur humanitäre Hilfe: Er setzt sich ein für Werte wie Menschenwürde, Gerechtigkeit und Recht. Sein Engagement zeigt, wie Kirche wirksam sein kann – nicht nur als Spenderin, sondern als öffentliches Gewissen, das mahnt, tröstet und fordert. In Konflikten wie in Gaza sind solche Stimmen unverzichtbar.
Weitere Information www.erzbistum-paderborn.de (Link)
www.soester-anzeiger.de (Link)
Papst Leo: Erneuter Appell für Gaza
Papst Leo XIV. hat einmal mehr zur Solidarität mit den Menschen im Gaza-Streifen aufgerufen. Bei seinem Angelusgebet an diesem Sonntag stellte er sich hinter „Initiativen in der ganzen Kirche, die den Brüdern und Schwestern, welche in diesem gemarterten Landstrich leiden, nahe sind“.
Weiterlesen auf www.vaticannews.va (Link)
UN werfen Israel Genozid im Gazastreifen vor
Eine UN-Kommission wirft Israel Völkermord im Gazastreifen vor – die Verantwortung dafür trage die höchste politische Ebene.
Israel begeht nach Auffassung der unabhängigen Untersuchungskommission des UN-Menschenrechtsrats im Gazastreifen Genozid. Vier der fünf in der UN-Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes von 1948 erwähnten Tatbestände seien erfüllt, befindet die dreiköpfige Kommission.
Weiterlesen auf www.tagesschau.de (Link)
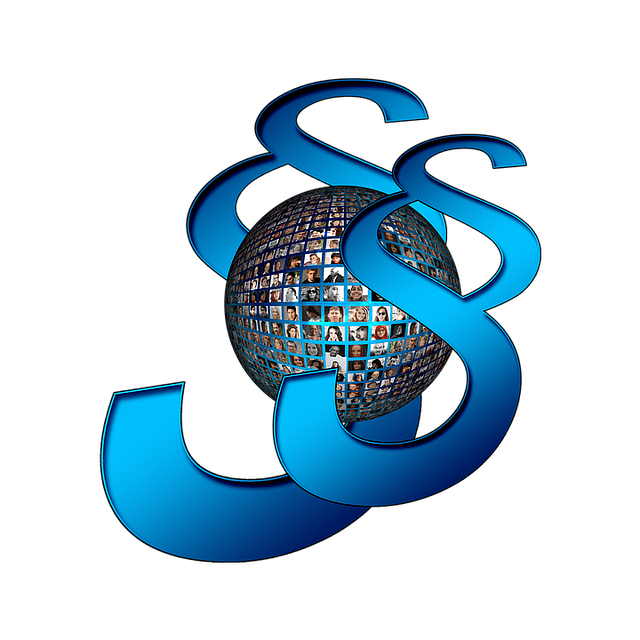
Was ist Völkermord?
Die Kriterien für Völkermord sind in der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes der Vereinten Nationen (UN-Genozidkonvention, 1948) festgelegt.
Dort wird Völkermord definiert als bestimmte Handlungen, die mit der Absicht begangen werden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören.
Handlungen, die als Völkermord gelten (Artikel II der Konvention):
- Tötung von Mitgliedern der Gruppe.
- Verursachung von schwerem körperlichem oder seelischem Schaden an Mitgliedern der Gruppe.
- Vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen, die darauf abzielen, die physische Zerstörung der Gruppe ganz oder teilweise herbeizuführen (z. B. Hunger, fehlende medizinische Versorgung, Zwangsumsiedlungen).
- Maßnahmen zur Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe.
- Gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe.
Wichtiger Zusatz:
- Zentral ist der spezifische Vernichtungswille („dolus specialis“). Das unterscheidet Völkermord von anderen Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
- Es reicht also nicht, dass massenhaft Zivilisten sterben – entscheidend ist die Absicht, eine geschützte Gruppe als solche zu vernichten.
Weitere Informationen auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung (Link)