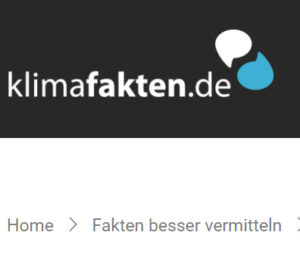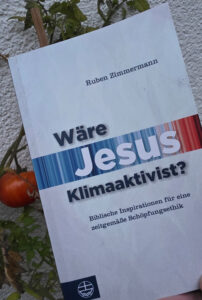Apostolisches Schreiben von Papst Leo, Oktober 2025

Disegnare nuove mappe di speranza von Papst Leo XIV (27. Oktober 2025) zum 60. Jubiläum der Erklärung Gravissimum educationis (28. Oktober 1965)
Für eine Welt, in der Menschen nicht nur überleben, sondern in Würde, Freiheit und Gemeinschaft leben können.
Das Schreiben liegt bisher nur in italiänischer Sprache vor (Link)
1. Proemium: Neue Landkarten der Hoffnung
Papst Leo XIV beginnt mit der Erinnerung, dass die Gravissimum educationis die Bedeutung der Bildung in der Kirche deutlich machte – nicht als bloße Zusatz-Aufgabe, sondern als eine „Trama“ (Gewebe) der Evangelisierung. Er betont, dass wir heute in einer Zeit rascher Veränderungen, großer Unsicherheit und pädagogischer Fragmentierung leben. In solchen Zeiten sei es umso nötiger, neue „Landkarten der Hoffnung“ zu entwerfen – Bildungsräume, die Brücken bauen und nicht Mauern hochziehen. Bildung sei nicht nur Wissensvermittlung, sondern eine dynamische Tat des Glaubens und der Kultur, die dazu beiträgt, dass der Evangelium „neue alle Dinge macht“ (vgl. Ap 21,5) – jede Generation hört, entdeckt und trägt weiter.
2. Eine Geschichte dynamischer Bildung
Im zweiten Teil zeichnet der Papst die historische Entwicklung der christlichen Bildungs- und Erziehungsarbeit nach.
- Er verweist auf die frühe Kirche, auf die Wüstenväter, auf den Monachismus, die ersten Universitäten – Bildung war immer schon mehr als Technik: sie war Formung des Menschen im Blick auf Wahrheit, Freiheit und Gemeinschaft.
- Er nennt exemplarisch Gestalten wie Augustinus von Hippo, Giovanni Battista de La Salle, Giovanni Bosco und Frauen wie Maria Montessori oder Katharine Drexel – sie alle haben Wege eröffnet, Bildung als Zugang zur Würde und Freiheit verstanden.
- Der Papst betont: Diese Tradition ist kein museumhaftes Relikt, sondern lebendig – sie stellt sich den Herausforderungen der Zeit mit Kreativität und Hoffnung.
3. Eine lebendige Tradition – Gemeinschaft und Hoffnung
Im dritten Abschnitt wird Bildung als gemeinschaftliches Geschehen verstanden – nicht isoliert durch den einzelnen Lehrer oder die einzelne Institution.
- Lernen erfolgt im „Wir“: Lehrende, Lernende, Familien, Kirche und Gesellschaft arbeiten gemeinsam.
- Eine zentrale Einsicht: Der Dialog von Glaube und Vernunft ist nicht optional; Bildung, die den Menschen ganzheitlich sieht, verbindet Wissen mit ethischem Urteilen, Technik mit Gewissen.
- Das Lehrer-, Erzieher- und Bildungsverständnis wird als Mission, als eine „Passion der Hoffnung“ gezeichnet: Bildung heißt Menschen zur Entfaltung bringen, nicht nur Fachwissen vermitteln.
4. Die Wegweisung der Gravissimum educationis
Der vierte Teil stellt zentrale Impulse der Gravissimum educationis (GE) heraus und wendet sie auf heutige Bedingungen an.
- Die GE betont das Recht auf Bildung für alle – Bildung darf nicht auf wenige Privilegierte beschränkt bleiben.
- Familie wird als „erste Schule der Menschlichkeit“ hervorgehoben.
- GE warnt vor einer Reduktion von Bildung auf rein funktionale Ausbildung oder ökonomische Verwertbarkeit – im Gegensatz dazu muss die Würde der Person, ihr Verhältnis zur Wahrheit und zum Guten im Zentrum stehen.
- Diese Vision – einer Bildung, die nicht nur Fach- und Leistungsprofil generiert, sondern Menschen im Ganzen formt – bleibt gültig und wegweisend.
5. Die Zentralität der Person
Im fünften Teil wird konkret, was es heißt, die Person in den Mittelpunkt zu setzen.
- Bildung bedeutet, das Leben einer Person zu erschließen: Sinn, Würde, Berufung, Verantwortung – nicht nur Fachkompetenz.
- Die Schule bzw. die katholische Bildungseinrichtung wird als lebendiger Raum verstanden, in dem Glaube, Kultur und Leben ineinanderwirken. Lehrende sind nicht nur Wissensvermittler, sondern Begleiterinnen und Begleiter im ganzen Menschen-Werdungsprozess.
- Zugleich wird die Rolle der Eltern stark betont: Sie haben das erste Erziehungsrecht und tragen zentrale Verantwortung – Bildungsstätten ergänzen, ersetzen aber nicht diesen Auftrag.
6. Identität und Subsidiarität
Der sechste Abschnitt greift zwei wichtige Prinzipien auf: Identität von Bildungseinrichtungen und das Prinzip der Subsidiarität.
- Es geht um die Identität katholischer Schulen und Universitäten: Sie dürfen nicht ihre konfessionelle Prägung verlieren, sondern sollen im Geist des Evangeliums wirken, Dialogbereitschaft zeigen und sich zugleich in die Gesellschaft einbringen.
- Das Prinzip der Subsidiarität wird betont: Bildungs- und Erziehungsarbeit gehört primär der Familie und den Bildungs-Trägern, der Staat hat unterstützende und regulierende Funktionen. Bildung darf nicht allein Marktlogik oder technokratischen Ansprüchen unterworfen werden.
7. Die Kontemplation der Schöpfung – Umwelt, Gerechtigkeit und Frieden
Im siebten Teil verbindet Papst Leo XIV Bildungsfragen mit globalen Herausforderungen: Schöpfung, Umwelt, Gerechtigkeit und Frieden.
- Bildung soll nicht nur intellektuell und technisch sein, sondern auch spirituell und ökologisch: Der Blick auf die Schöpfung hilft, den Menschen in Beziehung zu Gott, zu anderen und zur Natur zu sehen.
- In einer Welt, in der Umweltzerstörung oft die Armen trifft, hat Bildung die Aufgabe, Bewusstsein für ökologische Gerechtigkeit zu schaffen – und stilsichere Lebenshaltungen zu fördern: etwa Sobriety, Nachhaltigkeit, Solidarität.
- Frieden wird ausdrücklich als „kraftvolle Sanftmut“ verstanden – nicht nur als Abwesenheit von Konflikt, sondern als Haltung, die Gewalt ablehnt und Versöhnung sucht. Bildung muss verwundete Beziehungen heilen, Dialog fördern und zur aktiven Mitarbeit an einer gerechten und friedlichen Welt befähigen.
8. Eine „Bildungskostellation“
Der achte Teil verwendet das Bild einer „Costellazione educativa“ (Bildungs-Sternenkonstellation) für das Netzwerk katholischer Bildungsinstitutionen weltweit.
- Schulen, Universitäten, Fachschulen, Jugendpastoral, Bewegungen und laizistische Initiativen bilden gemeinsam dieses Netzwerk – jede Institution hat ihren eigenen Glanz, zusammen ergeben sie eine Richtung.
- Vielfalt wird nicht als Hindernis gesehen, sondern als Ressource: Unterschiedliche Methoden, Kontexte, Kulturen können sich ergänzen. Bildungsarbeit muss lokal verankert und gleichzeitig global vernetzt sein.
- Kooperation mit der Gesellschaft, mit zivilen Institutionen, öffentlichen Stellen und internationalen Netzwerken wird gefordert – gute Praxen teilen, Lern-Austausch ermöglichen, Bildungszugänge weltweit fördern.
9. Neue Räume „navigieren“ – Digitalisierung, KI, Technik
Der neunte Teil widmet sich dem großen Thema: Bildung im digitalen Zeitalter und mit Künstlicher Intelligenz.
- Digitalisierung und KI sind nicht per se schlecht – sie gehören „zum Plan Gottes für die Schöpfung“, wie der Papst sagt. Aber: Technik darf nicht die Person verdrängen, Gemeinschaft schwächen oder Bildung auf Effizienz und Standardisierung reduzieren.
- Bildungseinrichtungen müssen mutig sein, digitale Kompetenzen fördern, Didaktiken aktualisieren, Lehrende weiterbilden – aber stets kritisch und ethisch reflektiert. p
- Der Papst warnt vor Technokratie: Wenn Bildung nur noch auf messbare Ergebnisse, Plattformen und Algorithmen setzt, geht das Herz der Bildung verloren. Technik muss begleitet werden von Menschlichkeit: Poesie, Kunst, Freude an der Entdeckung, Irrtumsmöglichkeit.
10. Der Leuchtturm des Globalen Bildungspaktes
Im zehnten Abschnitt wird auf den Global Compact on Education (Weltweiter Bildungspakt) verwiesen, der von Papst Franziskus initiiert wurde.
- Der Pakt enthält sieben Leitpfade: Mensch im Zentrum, Kinder & Jugendliche anhören, Frauenwürdigung, Familie als erste Lehrerin, Offenheit zur Aufnahme, Erneuerung von Wirtschaft & Politik im Dienst des Menschen, Schutz des gemeinsamen Hauses.
- Der Papst sagt: 60 Jahre nach GE und fünf Jahre nach dem Pakt stehen wir heute vor neuen Dringlichkeiten. Die Herausforderungen sind größer, die Erwartungen andersartig – wir müssen nicht nur erhalten, sondern erneuern.
- Zusätzlich nennt er drei Prioritäten: (1) Leben derinnerlichkeit – junge Menschen suchen Tiefe, Stille, Dialog mit Gewissen und Gott; (2) digitaler Humanismus – Technik nutzen, aber den Menschen vor das Algorithmus-Diktat setzen; (3) „disarmed and disarming peace“ – Bildung zum Frieden: sprachliche und relationale Entwaffnung, Brücken bauen statt Mauern.
- Die katholische Bildungswelt verfügt über eine einzigartige Präsenz, besonders in armen Regionen – damit geht Verantwortung einher: Zugang schaffen, Qualität sichern, Bildung ermöglichen, in denen der Bildungszugang selten ist.
11. Neue Landkarten der Hoffnung – Schlusswort
Abschließend skizziert der Papst, was es heißt, neue Bildungs-Landkarten der Hoffnung zu zeichnen.
- Er fordert die Bildungs-Gemeinschaften auf: „Entwaffnet die Worte, hebt den Blick, bewahrt das Herz“.
- Entwaffnet die Worte: Bildung schreitet nicht mit Polemik, sondern mit Sanftmut, mit Zuhören.
- Hebt den Blick: Wie Abraham, der Sterne zählte (Gen 15,5) – fragt euch, wohin ihr geht und warum.
- Bewahrt das Herz: Beziehungen zuerst, Programme danach; die Person vor dem Profil.
- Er sagt: Unsere Zeit verlangt Vorbereitung, Tatkraft, Mut zur Erneuerung – und Bildung ist keine nostalgische Rückschau, sondern ein lebendiges Labor für Hoffnung.
- Der Papst schließt mit einer Weihe an Maria, Sitz der Weisheit („Sedes Sapientiae“) und allen Heiligen Erziehern und lädt alle – Pastoren, Lehrkräfte, Laien, Studierende – ein, „Diener der Bildungswelt, Choreographen der Hoffnung, unermüdliche Sucher der Weisheit, glaubwürdige Gestalter von Schönheit“ zu sein.
Zusammenfassende Bedeutung
Dieses Schreiben zeigt: Bildung im katholischen Kontext ist nicht nur Wissensvermittlung oder berufliche Qualifikation. Sie ist eine Bildung, die den ganzen Menschen im Blick hat – geistig, moralisch, sozial, ökologisch. Sie ist Gemeinschafts- und Zukunftsorientiert, sie weiß sich herausgefordert durch Digitalisierung, Ungleichheit, Umwelt-Krise und Frieden. Aber sie weiß sich auch getragen von einer langen Tradition, von der Vision der GE und dem Ruf der Kirche.
Papst Leo XIV ruft dazu auf, dass Bildung nicht passiv bleibt, sondern aktiv „Landkarten der Hoffnung“ zeichnet – für eine Welt, in der Menschen nicht nur überleben, sondern in Würde, Freiheit und Gemeinschaft leben können.