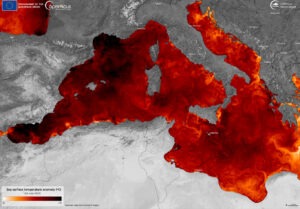Gegensätze anlässlich der Trauerfeier für den ultrarechten Aktivisten Charlie Kirk

Die Trauerfeier für den ultrarechten Aktivisten Charlie Kirk zeigte einen tiefen Riss, nicht nur politisch, sondern auch spirituell.
Seine Witwe, Erkia Kirk, sprach Worte, die das Publikum überraschten:
„Diesem Mann, diesem jungen Mann, vergebe ich. Ich vergebe ihm, weil es das war, was Christus getan hätte. Und weil es das ist, was Charlie tun würde.“
Sie rief damit ein Kernprinzip der christlichen Botschaft in Erinnerung: Vergebung, Nächstenliebe – ja sogar Feindesliebe.
Doch die Reden der republikanischen Politiker auf derselben Bühne schlugen einen ganz anderen Ton an. Kampfansagen dominierten, von offenen Bekenntnissen zum Hass bis hin zur Abgrenzung gegen politische Gegner:
„Ich hasse meine Gegner und wünsche ihnen nicht das Beste.“ (Trump)
Die Trauerfeier wurde so zu einem Spiegel: Zwischen der Möglichkeit, Schmerz in Vergebung zu verwandeln, und der Versuchung, Leid als Brennstoff für noch mehr Feindschaft zu nutzen. Erkia Kirks Worte erinnerten daran, dass Glauben mehr sein könnte als ein Banner im Kulturkampf – ein Weg, der nicht Hass, sondern Liebe ins Zentrum stellt.
Vergebung im Schatten des Hasses
Die Reden auf der Trauerfeier offenbaren einen tiefen Riss. Da stand seine Witwe, Erkia Kirk, mit zitternder Stimme, und sprach von Vergebung. Inmitten von Schmerz und Verlust hob sie nicht die Faust, sondern das Evangelium hoch – nicht als Dogma, sondern als Geste. Vergebung, Nächstenliebe, sogar Feindesliebe. Worte, die an die Bergpredigt erinnern, an den radikalen Anspruch Jesu, der Gewalt nicht mit Gegengewalt beantwortet, sondern mit Liebe.
Und dann die Politiker. Dieselbe Bühne, dieselbe Feier – aber ein ganz anderer Klang: Kampfansagen, Hassbekenntnisse, der offene Wunsch, den Gegnern das Schlechteste zu gönnen. „Ich hasse meine Gegner“, hieß es, als sei das ein Ausweis von Stärke. Doch was für eine Stärke ist es, die Hass braucht, um sich zu tragen?
Wie konnte ein solcher Kontrast so schmerzlos nebeneinanderstehen? Da die Witwe, die im Angesicht der größten persönlichen Wunde von Gnade spricht. Dort die politischen Weggefährten, die aus derselben Wunde Treibstoff für Ressentiment ziehen.
Zwei völlig verschiedene Christentümer
Es ist, als ob zwei völlig verschiedene Christentümer sichtbar wurden. Das eine, das sich an die unbequeme Zumutung Jesu hält: den Feind lieben, nicht weil es leichtfällt, sondern gerade weil es schwer ist. Das andere, das „christliche Werte“ im Munde führt, aber in Wirklichkeit nur einen Kulturkampf führt, Religion missbraucht und in dem Nächstenliebe als Schwäche gilt.
Die bittere Wahrheit
Vielleicht ist genau das die bittere Wahrheit dieser Feier: dass Worte wie „Christus“ und „Vergebung“ heute zwar noch ausgesprochen werden, aber nicht mehr denselben Raum füllen. Und dass es manchmal die Trauer einer Witwe braucht, um uns daran zu erinnern, dass die eigentliche Zumutung des Evangeliums nicht der Kampf gegen Gegner ist – sondern die Bereitschaft, ihnen zu vergeben.
FJ Klausdeinken
Christliche Extremisten und Islamisten
Christliche Extremisten und Islamisten ähneln sich darin, dass sie eine Religion nicht nur als Glaubenssystem, sondern als politische Ideologie begreifen. Beide missbrauchen die spirituelle Botschaft ihrer Tradition, um Machtansprüche zu legitimieren, Andersdenkende auszugrenzen und autoritäre Strukturen aufzubauen. Während Islamisten einen Gottesstaat nach islamischem Recht fordern, zielen christliche Extremisten etwa in Form von christlichem Nationalismus oder Dominionismus darauf ab, Gesellschaft und Politik nach einer rigiden Bibelauslegung zu formen. In beiden Fällen steht nicht der Glaube im Zentrum, sondern der politische Wille zur Kontrolle – mit Religion als Werkzeug.
Wie religiöse Rechte die USA zum Gottesstaat machen wollen
Evangelikale Bewegungen wie die „Neue Apostolische Reformation“ wollen eine christliche Vorherrschaft in den USA: statt Demokratie und Rechtsstaat eine christlich-fundamentalistische Autokratie. Ihr Einfluss reicht bis ins Weiße Haus.
Weiterlesen auf www.deutschlandfunk.de (Link)
Christofaschismus
Die Theologin Dorothee Sölle prägte in den 1970er-Jahren den Begriff „Christofaschismus“, um eine bestimmte autoritäre und gewaltsame Ausprägung des Christentums zu kritisieren. Sie verstand darunter die Verquickung von christlichem Glauben mit totalitären, nationalistischen und ausgrenzenden Strukturen.
Die vier zentralen Charakteristika des Christofaschismus nach Sölle sind:
- Autoritarismus – ein Gottesbild, das Gehorsam verlangt und hierarchische Strukturen heiligt.
- Nationalismus – die Verbindung von Glaube mit nationaler Überhöhung und Abwertung anderer Völker oder Kulturen.
- Sexismus und Patriarchat – die Verfestigung traditioneller, ungleicher Rollenbilder zwischen Männern und Frauen.
- Legitimation von Gewalt – die religiöse Rechtfertigung von Krieg, Unterdrückung und Gewalt gegen Andersdenkende oder „Ungläubige“.
Sölle wollte mit diesem Begriff nicht das Christentum an sich verwerfen, sondern auf die Gefahren hinweisen, wenn Religion als ideologisches Machtinstrument missbraucht wird.
„Jeder Mensch braucht einen Hoffnungsschrank, in dem wir die Erfahrungen von Befreiung sammeln“; Dorothee Sölle

Bätzing warnt vor antidemokratischer katholischer Bewegung
Bätzing bezog sich vor allem auf die sogenannte neo-integralistische Bewegung, die in den vergangenen Jahren in den USA und in Europa an Zulauf gewonnen hat. Ihre Vertreter halten die liberale Demokratie für gescheitert und wollen sie durch eine Art katholischen Gottesstaat ersetzen.
Weiterlesen auf www.deutschlandfunk.de (Link)