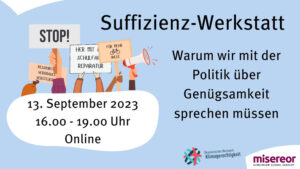Kirche und der Anspruch des Tierschutzes – ein Kommentar von FJ Klausdeinken

Die Kirchen – evangelisch wie katholisch – stehen aktuell in einem spannungsvollen Zwiespalt: auf der einen Seite große theologische und ethische Ansprüche, auf der anderen Seite eine Praxis, die diese Ansprüche allzu oft nicht vollständig erfüllt. Ein besonders deutlicher Bereich dieser Diskrepanz ist der Umgang mit Tieren und der Fleischkonsum.
Die Realität: Fleisch ohne Reflexion
Organisationen wie Will Kirche Tierschutz? weisen auf erschreckende Zustände hin: Aus ihren Analysen ergibt sich, dass ein Großteil der kirchlichen Einrichtungen Fleisch aus Massentierhaltung verwendet – Schulen, Kindertagesstätten, Pflegeeinrichtungen sowie kirchliche Veranstaltungen. will-kirche-tierschutz.de
Auch in der Fastenzeit, traditionell eine Zeit der Enthaltsamkeit und Besinnung, wird Fleisch oftmals weiterhin konsumiert – ohne dass in größerem Rahmen über die Herkunft, Tierwohl oder ökologische Folgen nachgedacht wird. Bei Großveranstaltungen kirchlicher Gemeinden, Gemeindefesten oder kirchlichen Festtagen gelten Fleischgerichte häufig als Standard. Diese Praxis lässt kaum Raum für ernsthafte Reflexion über das Leiden in der Massentierhaltung oder die Verantwortung der Kirche als Teil der Schöpfung.
Das Evangelium: Nächstenliebe und Schöpfungsliebe
Dem gegenüber steht die zentrale Botschaft der biblischen Schrift: Gott ist der Schöpfer aller Wesen, nicht nur der Menschen. In Genesis heißt es, Gott segnet Mensch und Tier und spricht: „Siehe, ich habe euch alles gegeben, was sich regt auf der Erde.“ (Genesis 1,28). Und: „Denn alles, was lebt, ist dein, Herr.“ (1.Chronik 29,12) – ein Hinweis darauf, dass das Leben der Tiere Teil des göttlichen Haushalts ist.
Jesus selbst verbindet Nächstenliebe nicht nur mit dem Mitmenschen, sondern auch mit der Sorge um Schwächere: Wer sich um das Leid kümmert, wer Gerechtigkeit sucht – das schließt ethische Verantwortung mit ein. Der Apostel Paulus schreibt, dass wir „das Gute tun“ sollen und „nicht zu Toren werden sollen, sondern Einsicht“. (Epheser 5,15–17) – und „das Angemessene“ sei maßvolles Leben, nicht Verschwendung oder Gleichgültigkeit gegenüber Schuld, Leid und Ausbeutung.
Auch das alttestamentliche Gebot, den Bruder oder die Schwester im Fremden zu versorgen, enthält Analogien: Tiere sind oft die Fremden, die wir sehen, aber deren Stimme wir überhören. Laut biblischer Tradition sind Mensch und Tier Teil der Schöpfung, die Gott anvertraut ist, wie etwa in Psalm 50,10: „Denn meine ist alles Wild im Wald, das Vieh auf tausend Hügeln.“ Das heißt: wir sind nicht alleinige Besitzer, sondern Verwalter und Verantwortungsträger.
Die ambivalente Haltung: Ursachen und Spannungsfelder
Warum gelingt es der Kirche – trotz dieser klaren Bibeltexte und trotz dem Bewusstsein vieler Gemeindeglieder – nicht, konsequent zu handeln?
- Tradition und kulturelle Gewohnheiten
Fleischgenuss ist in vielen Kulturen fest verwurzelt, auch innerhalb kirchlicher Feste. Gewohnheiten ändern sich langsam. Das prägt auch, was in Kantinen, Gemeindecafés oder Veranstaltungen serviert wird. - Praktische und organisatorische Hindernisse
Biofleisch ist teurer, Lieferketten sind komplexer, und oft fehlt eine verbindliche Richtlinie oder Verordnung innerhalb der Kirche oder Kommune, die nachhaltige Beschaffung vorschreibt. Will Kirche Tierschutz? fordert etwa, dass Kirche bis Ende 2025 für alle ihre landeskirchlichen und bischöflichen Einrichtungen eine Bio-Beschaffung aller tierlichen Produkte verbindlich festlegt. will-kirche-tierschutz.de - Wirtschaftliche Interessen und Denkmodels
Kirchliche Einrichtungen haben Budgets, Verträge mit Lieferanten, und oftmals steht Effizienz im Vordergrund – Preis, Menge, Verfügbarkeit. Allein die Umstellung auf tierfreundlichere, umweltschonendere Produkte würde Kosten verändern und möglicherweise Widerstand auslösen. - Theologische Unsicherheit und Prioritätensetzung
Manche sehen Tierschutz nicht als zentrales Thema der Verkündigung oder Kirche, sondern eher als Randthema. Es wird argumentiert, das Evangelium konzentriere sich primär auf Menschen, ihre Rettung, Gerechtigkeit, die Armen – Tierschutz gerät in den Schatten.
Forderungen und mögliche Wege zur Überwindung der Ambivalenz
Die Initiative Will Kirche Tierschutz? macht konkrete Vorschläge, wie die Kirche glaubwürdiger werden kann:
- Bio-Beschaffung aller tierlicher Produkte in kirchlichen Einrichtungen.
- Transparenz, z. B. durch ein Kirchen-Tierschutz-Label, das darlegt, wie Gemeinden und Einrichtungen sich beim Tierschutz positionieren.
- Empfehlung einer pflanzlichen Ernährung als zeitgemäße, tierfreundliche und gesunde Form – nicht zwingend verpflichtend, aber als ethischer Kompass und Vorbildfunktion.
Diese Forderungen greifen genau dort an, wo Praktiken und Theologie auseinanderdriften: Ernährung, Beschaffung und öffentliche Glaubwürdigkeit.
Biblische Verpflichtung und kirchliche Glaubwürdigkeit
Wenn Kirche das Evangelium vertritt, kann sie nicht neutral bleiben gegenüber den Fragen, wie wir Leben – mit Menschen, aber auch mit Tieren – gestalten. Die Lehre von der Schöpfung ist kein schmückendes Beiwerk, sondern zentral: sie definiert, wie wir uns als Geschöpf innerhalb der Schöpfung verhalten sollen.
Wie Jesus den verlorenen Sohn sucht oder das verlorene Schaf hervorhebt (vgl. Lukas 15) – das Schaf als Symbol für etwas Kleines, Übersehenes, das Bedeutung hat – so sind Tiere und ihre Leiden nicht peripher. Wenn die Kirche ihre Aufgabe ernst nimmt, dann beinhaltet dies auch: sich für die Schwachen einzusetzen, auch wenn sie keine Menschen sind, und Verantwortung für das ganze Erschaffene zu übernehmen.
Die Apostelgeschichte ruft zur Gemeinschaft auf: „Sie waren alle beieinander und hatten alles gemeinsam.“ (Apg 2,44) – auch hier schwingt der Gedanke mit, nicht nur an das eigene Wohl, sondern an das Wohl aller Beteiligten – Menschen, Tiere und Umwelt.
Ein Aufruf zur Kohärenz
Kirche hat eine Rolle als moralische Stimme, als ethisch-leuchtender Pol in der Gesellschaft. Glaubwürdigkeit hängt nicht nur vom Wort ab, sondern vor allem vom gelebten Beispiel. Wenn Kirchen öffentlich predigen von Liebe, Gerechtigkeit und Schöpfung, dann sollten sie auch in ihren Kantinen, ihren Beschaffungsrichtlinien und ihren Festen zeigen, wie diese Werte konkret aussehen.
Es geht nicht darum, Dogmen aufzuerlegen, sondern einen Weg zu gehen, der Schritt für Schritt an den biblischen Anspruch anschließt. Es geht darum, dass Glaube und Ethik Hand in Hand gehen, dass Kirche nicht nur spricht, sondern entsprechend handelt.
Zur Kampagne auf will-kirche-tierschutz.de (Link)
Kirche als #Verständigungsort und Hoffnungsort

Teile der Karikaturenausstellung „Glänzende Aussichten“ von Misereor thematisieren das Verhältnis von Mensch und Tier. Diese Exponate werden in der Wiesenkirche ausgestellt.
Ergänzend gibt es ein Bild von „Will Kirche Tierschutz“. Es zeigt eine Abendmahlszene und stellt eine kritische Frage.
Wir danken, dass dieses provozierende Bild direkt unter der historischen, westfälischen Abendmahlszene platziert ist.


Auf dem Tisch stehen typisch westfälische Speisen: Ein Schweinskopf und ein Schinken, Roggenbrot und Bier. Auch der Schnaps, der in Westfalen nach einer deftigen Mahlzeit dazugehört, darf nicht fehlen. So eine volkstümliche Darstellung spricht den Betrachter an. (Text und Bild www.wiesenkirche.de)

Informationsstand der Initiative „Will Kirche Tierschutz“ auf dem Tag der Schöpfung des ACK auf Haus Düsse
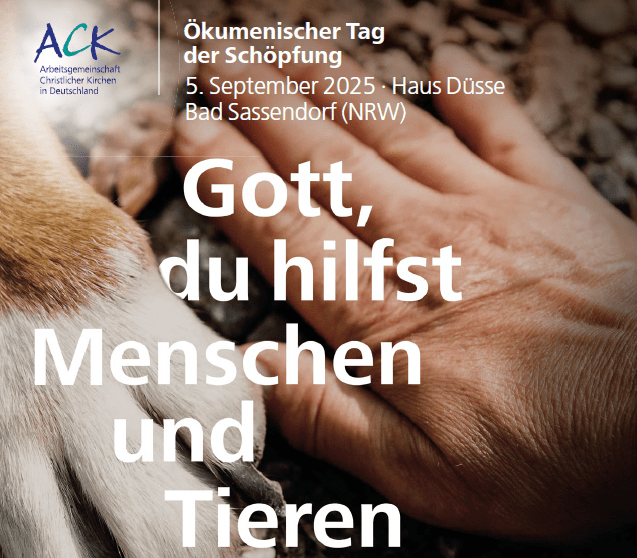
Einlandungsplakat der ACK zum Tag der Schöpfung