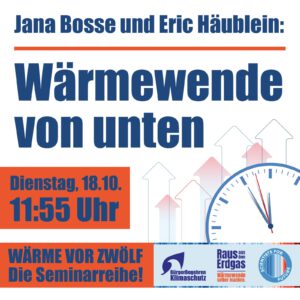Evangelische Friedensethik angesichts neuer Herausforderungen
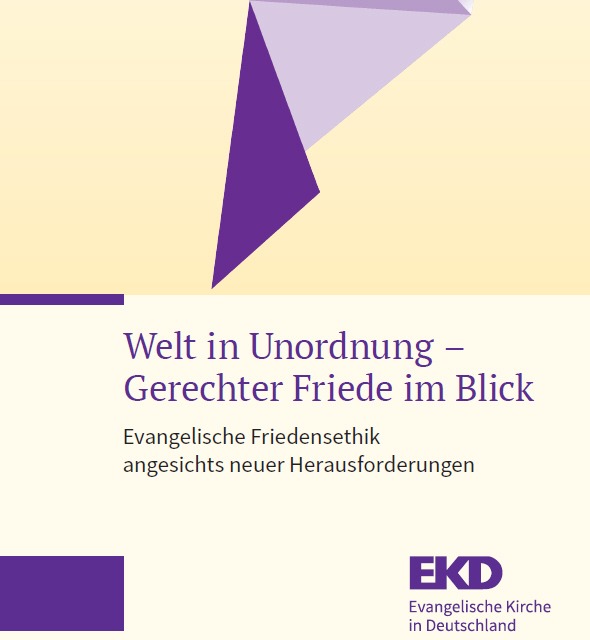
Mit der neuen Denkschrift „Welt in Unordnung – Gerechter Friede im Blick“ legt die EKD im November 2025 ein wichtiges ethisches Orientierungsdokument vor. Sie geht davon aus, dass wir in einer Welt leben, die zunehmend unruhig, komplex und unübersichtlich geworden ist — eine Welt nämlich „in Unordnung“. Die Herausforderung lautet: Wie kann eine christlich-fundierte Friedensethik aussehen, die dieser neuen Realität gerecht wird?
Grundüberzeugungen der Friedensethik
Die Denkschrift beruft sich auf vier zentrale Überzeugungen des christlichen Glaubens:
- Das Leben und Wirken von Jesus Christus: Er hat Gewalt nicht zurückgegehrt, hat Feinden vergeben und damit ein radikales Zeichen gesetzt.
- Das Gebot der Nächsten- und Feindesliebe: Nicht nur die Freundinnen, sondern auch die Feindinnen sind in ethischer Verantwortung einzubeziehen.
- Die Gleichheit aller Menschen vor Gott: Hautfarbe, Religion, Nation – alles darf keine Trennlinie sein.
- Die Realität der Sünde und des Menschen als zugleich gut und fehlbar: Der Friede bleibt eine Aufgabe, kein erreichter Endzustand.
Diese Überzeugungen bilden das Fundament – zugleich wird anerkannt, dass sie in einer unerlösten Welt mit Gewalt- und Machtstrukturen agieren müssen.
Das Leitbild „Gerechter Friede“
Im Zentrum der Denkschrift steht das Konzept des „Gerechten Friedens“. Frieden wird hier nicht nur als Abwesenheit von Krieg verstanden, sondern als ein Prozess, in dem Gewalt zurückgedrängt und Gerechtigkeit gefördert wird.
Vier Dimensionen des gerechten Friedens werden genannt:
- Schutz vor Gewalt – Menschen müssen sicher leben können, ohne ständige Angst vor Krieg oder Willkür.
- Förderung von Freiheit – Meinungsfreiheit, Glaubensfreiheit, berufliche Selbstbestimmung gehören dazu.
- Abbau von Ungleichheiten – Extreme Unterschiede bergen Konfliktpotenzial; gerechter Friede will Ausgleich fördern.
- Friedensfördernder Umgang mit Vielfalt – Kultur, Religion, Lebensentwürfe sind bereichernd, führen aber auch zu Spannungen, wenn sie nicht in einen friedlichen Umgang eingebettet sind.
Interessant: Die Denkschrift hebt explizit den Schutz vor Gewalt als Fundament hervor – ohne Sicherheit könne Freiheit, Gerechtigkeit und Vielfalt nicht gedeihen.
Neuorientierung der Friedensethik – zentrale Themen
Die Denkschrift zeigt, dass die EKD ihre Friedensethik neu kalibriert hat: Das Ideal der Gewaltfreiheit bleibt zentral, aber die Realität von Bedrohung, Recht und Krieg wird stärker berücksichtigt.
Einige konkrete Herausforderungen:
- Hybride Kriegsführung: Nicht nur klassische Schlachten, sondern Desinformation, Cyberangriffe, wirtschaftliche und kulturelle Eingriffe destabilisieren demokratische Gesellschaften.
- Terrorismus: Die Denkschrift warnt vor einer Politik der Angst, die dem Terrorismus Vorschub leisten kann. Pauschale Beschränkungen von Schutzsuchenden werden als ethisch nicht vertretbar genannt.
- Atomwaffen: Sie werden als ethisch verwerflich bezeichnet, stehen aber zugleich im Spannungsfeld politischer Abschreckung – ein unauflösbares Dilemma.
- Rüstungsexporte: Waffenlieferungen dürfen nur dem Schutz von Zivilbevölkerung und der Wiederherstellung von Frieden dienen – nicht Machtprojektionen. Eine generelle Pflicht zur Lieferung wird ausgeschlossen, stattdessen individuelle Einzelfallabwägung gefordert.
- Dienstpflicht & Wehrpflicht: Die Denkschrift betont Freiwilligkeit, sieht aber an, dass staatlicher Schutzpflicht Rechnung getragen werden muss. Auch zivile Dienste gelten dem Frieden.
- Klimagerechtigkeit: Umweltzerstörung, Klimawandel und ungleiche Folgen sind Konflikttreiber – daher gehört Klimagerechtigkeit zur Friedenspolitik.
Persönliche Reflexion und Bedeutung
Die Denkschrift spricht in einer Zeit, in der uns die Grenzen zwischen Frieden und Krieg, zwischen Sicherheit und Freiheit zunehmend bewusst werden. Sie zeigt: Frieden ist kein Zustand, sondern eine Aufgabe – und eine ethische Herausforderung.
Mir fällt dabei auf:
- Der Mut zur Realität: Gewalt, Krieg, Macht und Technologie-Risiken werden nicht ausgeblendet, sondern ernst genommen.
- Das feste Festhalten am Glauben – zugleich mit Augenmaß: Das christliche Ideal von Gewaltfreiheit bleibt, aber es wird anerkannt, dass Schutz vor Gewalt eine Realität ist, der man sich stellen muss.
- Der breite Horizont: Frieden wird nicht isoliert als militärisches Phänomen gesehen, sondern im Zusammenspiel mit Gerechtigkeit, Freiheit und Vielfalt – und sogar Umwelt- und Klimafragen werden integriert.
- Die Einladung zur Verantwortung: Jede und jeder ist angesprochen – nicht nur Staaten oder Kirchen –, sondern auch Einzelpersonen, Gemeinden, Zivilgesellschaft. Frieden beginnt im Kleinen, im alltäglichen Tun.
Ausblick – was heißt das für uns?
Was bedeutet das konkret für unser persönliches oder gesellschaftliches Handeln? Einige Überlegungen:
- Bildung und Aufklärung gewinnen immense Bedeutung – besonders angesichts hybrider Kriegsführung und Desinformation. Wir sind gefragt, Medienkompetenz zu stärken und demokratische Kultur zu pflegen.
- Zivilgesellschaftliches Engagement zählt: Friedensförderung braucht nicht nur Reglemente, sondern konkrete Initiativen für Vielfalt, Teilhabe, Gerechtigkeit.
- Nachhaltigkeit und Umweltpolitik sind Friedenspolitik: Maßnahmen gegen Klimawandel und Umweltzerstörung sind zugleich Maßnahmen gegen Gewalt- und Konfliktpotenziale.
- Verantwortung beim Thema Rüstung und Sicherheit übernehmen: Diskussionen über Waffenexporte, Verteidigung und Dienstpflicht betreffen uns alle – dabei bleibt ethisches Bewusstsein zentral.
- Kirche und Glaubende sind nicht allein Zuschauer: Die EKD sieht sich selbst in der Rolle der Begleitung, Orientierung und theologischen Stimme – aber nicht als Entscheiderin politischer Maßnahmen. EKD
Schlusswort
In einer Welt, die sich verschoben hat — geopolitisch, technologisch, kulturell — ist die Denkschrift der EKD ein wichtiges Zeichen. Sie lädt ein, das Friedensideal nicht als nostalgisches Relikt zu sehen, sondern als lebendige und herausfordernde Aufgabe für heute. Frieden ist möglich – aber er entsteht nicht von allein. Ein gerechter Friede verlangt Schutz, Freiheit, Gerechtigkeit und den klugen Umgang mit Vielfalt. Und er verlangt unsere bewusste Mit- und Gegenwirkung.
Ich finde: Diese neue Orientierung ist ein wertvoller Beitrag – nicht nur für Kirche oder Theologie, sondern für unsere Gesellschaft insgesamt. Wenn Du willst, kann ich die Kernaussagen in einer kompakten Übersicht oder Arbeitsgrundlage für Gemeinde oder Schule aufbereiten. Möchtest Du das?
Weiterlesen auf www.ekd.de (Link) oder (Link)
Dirket zur Denkschrift als Download (pdf)