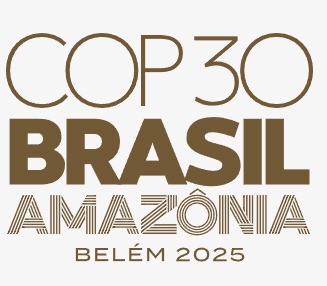
Auf der UN-Klimakonferenz COP30 im brasilianischen Belém hat Kardinal Pablo Virgilio David einen ungewöhnlichen, aber provokanten Vorschlag in die internationale Klimadebatte eingebracht: eine weltweite „Erd-Steuer“ auf fossile Brennstoffe. Die Maßnahme soll Länder verpflichten, für jedes Barrel Öl oder jede Tonne Kohle, die aus dem Boden geholt wird, einen festen Beitrag zu zahlen. Die Einnahmen sollen indigenen Gemeinschaften zugutekommen – jenen Menschen, die laut David „die wahren Hüter der Schöpfung“ sind.
Ein Vorschlag aus der Sicht eines besonders betroffenen Landes
Der Kardinal stammt von den Philippinen, einem Land, das seit Jahren immer heftigere Taifune und Überschwemmungen erlebt. In Belém schilderte er, wie Naturkatastrophen zunehmend Leben und Infrastruktur zerstören. Doch für David sind diese Ereignisse nicht nur Folgen des Klimawandels, sondern auch einer globalen Verantwortungslosigkeit: „Wir machen es viel zu einfach, die Natur zu missbrauchen“, sagte er in einem Interview.
Die Erd-Steuer soll genau hier ansetzen. Nicht erst, wenn Emissionen entstehen, sondern unmittelbar bei der Extraktion fossiler Ressourcen – also dort, wo Klimaschäden beginnen. Staaten, die Öl, Gas oder Kohle fördern, sollen einen obligatorischen Beitrag in einen internationalen Fonds einzahlen. Über die Vereinten Nationen würden die Mittel anschließend an indigene Gruppen verteilt, um Wälder, Küsten oder Korallenriffe wiederherzustellen.
Indigene als Schlüsselakteure des Schutzes
David betonte, dass indigene Gemeinschaften weltweit zu den effektivsten Beschützern natürlicher Lebensräume gehören. Gleichzeitig sind sie häufig die ersten, die unter Umweltzerstörung leiden. Mit der vorgeschlagenen Erd-Steuer könnten sie Projekte zur Renaturierung und nachhaltigen Bewirtschaftung ihrer Gebiete finanzieren – und damit auch einen Beitrag zur globalen Klimastabilität leisten.
Der Vorschlag des Kardinals ist damit nicht nur ein wirtschaftliches Instrument, sondern auch ein politisches Signal: Klimagerechtigkeit beginnt dort, wo diejenigen unterstützt werden, die am wenigsten zur Krise beigetragen haben.
Klimapolitik als moralische Aufgabe
Auffällig ist der moralische Ton, den David in seinen Ausführungen anschlägt. Er spricht von „ökologischer Bekehrung“ und knüpft den Umgang mit der Natur an spirituelle Kategorien wie Schuld, Reue und Wiedergutmachung. In Zeiten globaler Verunsicherung sei es notwendig, nicht nur über Technologien und Emissionen zu sprechen, sondern über Verantwortung und Haltung.
Dabei warnt der Kardinal ausdrücklich vor Schuldzuweisungen. Sein Anliegen sei nicht, mit dem Finger auf Länder oder Unternehmen zu zeigen. „Es geht darum, gemeinsam zu handeln“, sagt er. Die Menschheit habe noch die Chance, „ihr gemeinsames Zuhause zu retten“ – doch dazu brauche es konkrete Schritte.
Ein radikaler Vorschlag – und viele offene Fragen
Ob eine Erd-Steuer international realistisch ist, bleibt fraglich. Staaten, deren Wirtschaft stark von fossilen Energieträgern abhängt, dürften erheblichen Widerstand leisten. Auch die Frage der konkreten Berechnung und Verteilung der Mittel wäre komplex.
Dennoch: Der Vorschlag hat die Debatte auf der COP30 um eine neue Perspektive bereichert. Er verlagert den Fokus von technokratischen Lösungen hin zu einer ethischen Diskussion über Verantwortung, Gerechtigkeit und den Preis, den die Welt für ihren Ressourcenhunger gezahlt hat – und weiterhin zahlt.
Fazit
Kardinal David setzt mit seiner Forderung nach einer Erd-Steuer ein deutliches Zeichen. Sein Appell verbindet Umweltpolitik mit Moral und stellt die Frage, ob die globalen Klimaanstrengungen ohne eine grundlegende Haltungsänderung überhaupt ausreichen können. In einer Zeit, in der die Klimakrise sichtbarer wird denn je, bringt er damit einen Impuls ein, der weit über die Konferenzräume von Belém hinausweist.
Weiterlesen auf www.vaticannews.va (Link)
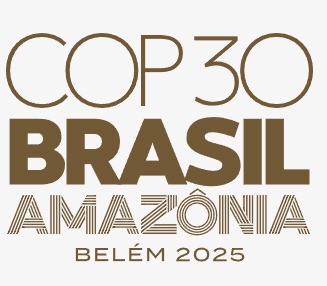
Vatikan hofft auf „Kurswechsel“ in Klimapolitik
In Belém hat der Klimagipfel COP30 begonnen. Der Apostolische Nuntius in Brasilien, Giambattista Diquattro, macht deutlich: Es braucht nicht nur eine Teiländerung des Kurswechsels in der internationalen Klimapolitik – sondern eine „neue Art, gemeinsam voranzugehen“.
Der Heilige Stuhl fordert effiziente, verbindliche und prüfbare Maßnahmen in den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Abschaffung fossiler Brennstoffe und einer Bildungs- und Lebensstilkomponente. Zudem wird eine Reform der globalen Finanzarchitektur ins Spiel gebracht, um die Verantwortung der Industriestaaten gegenüber den stärker vom Klimawandel betroffenen Ländern zu erkennen.
Aus christlicher Perspektive lassen sich diese Einsichten weiterdenken:
- Schöpfungsverantwortung
Die christliche Tradition sieht die Natur nicht primär als Ressource, die man nutzen kann, sondern als Gabe und Mitwelt Gottes. Der Mensch ist nicht nur Nutzer, sondern Bewahrer (vgl. Gen 2,15). Der Aufruf des Heiligen Stuhls zur „ganzheitlichen Ökologie“ greift diesen Gedanken auf: Bildung über Umwelt, Lebensstil-Reflexion und die Beziehung zwischen Mensch und Umwelt sind zentral.
Das bedeutet konkret: Wenn Politik sich Wandeln verpflichtet, dann ist das nicht nur eine technische oder wirtschaftliche Frage, sondern eine ethisch-theologische: Wie wollen wir leben? Welche Verantwortung übernehmen wir gegenüber künftigen Generationen, gegenüber der Mitwelt? - Gerechtigkeit und Solidarität
Der Artikel nennt den „gerechten Übergang“ – sozial, ökologisch und wirtschaftlich – sowie die Belastung von Frauen durch den Klimawandel.
Christlich gesehen ist Solidarität ein Schlüsselbegriff: Wir gehören zusammen, Grenzen und Unterschiede ausgelagert. Wenn Klimaschäden vor allem ärmere Länder treffen oder Bevölkerungsgruppen, dann handelt es sich um eine Gerechtigkeitsfrage. Die Forderung nach Reform der Finanzarchitektur („ökologische Schuld entwickelter Staaten“) kann als Ausdruck dieser Gerechtigkeit verstanden werden.
Hier entsteht eine Verbindung: Umweltschutz ist nicht nur ökologische Frage, sondern eine Frage der Mitmenschlichkeit. - Umkehr und Lebensstil
Der Heilige Stuhl spricht auch von einem Lebensstil weniger abhängig von fossilen Brennstoffen und einem Bildungsprozess zu einer ganzheitlichen Ökologie.
In der christlichen Spiritualität heißt das: Umkehr – nicht nur individuell, sondern gemeinschaftlich. Ein Lebensstil, der Maß hält, der bewusst konsumiert, der auf Gerechtigkeit achtet. Wenn Politik und Technik wichtige Rollen spielen, so bleibt die Veränderung des Herzens, der Haltung, der alltäglichen Entscheidungen unverzichtbar. - Hoffnung und Verantwortung
Der Nuntius spricht von einem „Zeichen der Hoffnung“, das gesetzt werden muss.
Christliche Hoffnung ist keine naive Wunschvorstellung, sondern eine aktive Haltung: Wir sind herausgefordert, Verantwortung zu übernehmen, mit Mut und Ausdauer. Der Wandel ist möglich – wenn wir ihn gemeinsam angehen. Der Begriff „gemeinsam“ verweist auf Gemeinschaft: Kirche, Staat, Zivilgesellschaft, Einzelne. - Praktische Handlungsfelder
Aus den genannten Bereichen ergeben sich konkrete Felder:- Bildung und Bewusstseinsbildung: Schulen, Gemeindegruppen, kirchliche Organisationen können Themen wie ökologische Ethik, Nachhaltigkeit, Verbrauch bewusst aufgreifen.
- Energie- und Ressourcenpolitik: Auch kirchliche Einrichtungen können ihre Gebäude, Mobilität, Beschaffung überprüfen.
- Solidaritäts- und Gerechtigkeitsprojekte: Unterstützung von Maßnahmen in Ländern des Globalen Südens, Projekte zur Wiedergutmachung oder Entschuldung sowie Klimaanpassung.
- Lebensstil: Weniger Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, bewusster Konsum, Repair & Reuse, Mobilität mit weniger Emission.
Fazit
Der Beitrag des Heiligen Stuhls auf der COP30 zeigt: Der Klimawandel ist nicht nur eine technische Herausforderung, sondern eine zutiefst ethische und spirituelle. Aus christlicher Sicht heißt das: Wir sind nicht lediglich Opfer oder Zuschauer – wir sind Teil der Schöpfung, mit Auftrag zur Fürsorge. Wir sind nicht nur Konsumenten – sondern Mitverantwortliche. Und wir sind nicht nur Zukunftsängstliche – sondern Hoffnungsträger. Wenn ein Kurswechsel in der Klimapolitik gelingt, so braucht er unsere Haltung, unsere Lebensweise, unseren Glauben mit.
Den Beitrag lesen auf www.vaticannews.va (Link)


