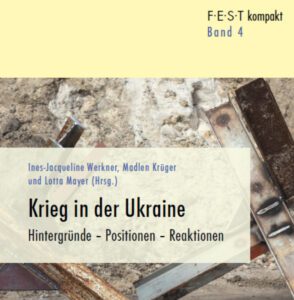erstes offizielles Lehrschreiben veröffentlicht
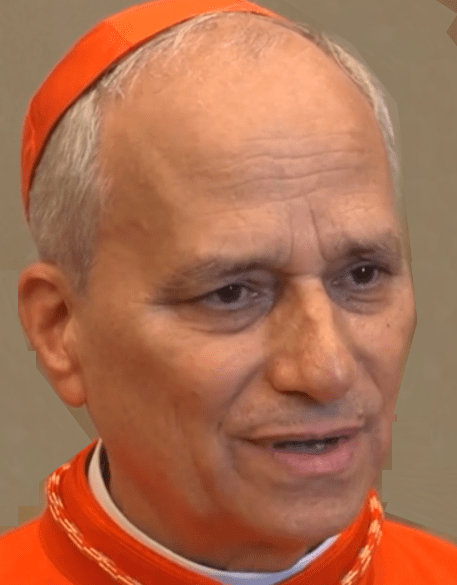
Einleitung
»Ich [habe] dir meine Liebe zugewandt« (Offb 3,9), sagt der Herr zu einer christlichen Gemeinde, die im Gegensatz zu anderen keine Bedeutung oder Ressourcen hatte und Gewalt und Verachtung ausgesetzt war: Auch wenn »du nur geringe Kraft hast, werde ich sie kommen lassen, damit sie sich vor dir niederwerfen« (vgl. Offb 3,8-9). Dieser Text erinnert an die Worte des Lobgesangs Marias: »Er stürzt die Mächtigen vom
Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen« (Lk 1,52-53).
„Für mich dieses hier: ‚Christen dürfen die Armen nicht bloß als soziales Problem betrachten: Sie sind eine ‚Familienangelegenheit‘. Sie gehören ‚zu den Unsrigen‘.‘ Heißt übersetzt: Wir sind nichts Besseres; kein Grund, die Nase hoch zu tragen. Das ist Evangelium pur.“
Die Liebeserklärung im Buch der Offenbarung des Johannes verweist auf das unerschöpfliche Geheimnis, das Papst Franziskus in seiner Enzyklika Dilexit nos über die göttliche und menschliche Liebe des Herzens Christi vertieft hat. Darin haben wir bewundert, wie Jesus sich »mit den Geringsten der Gesellschaft« identifizierte und wie er durch seine vollendete liebende Hingabe die Würde jedes Menschen sichtbar
gemacht hat, umso mehr, »je schwächer, elender und leidender er ist«.[1] Die Liebe Christi zu betrachten »hilft uns, den Leiden und Nöten der anderen mehr Aufmerksamkeit zu schenken, und macht uns stark, an seinem Werk der Befreiung mitzuwirken, als Werkzeuge für die Verbreitung seiner Liebe«.[2]
zum Apostolischen Lehrschreiben des Papstes auf press.vatican.va (Link)
Kernbotschaft
- Titel „Dilexi te“ („Ich habe dich geliebt“) – Hinweis auf Jesu Zuwendung zu den Schwachen (vgl. Offb 3,9).
- Hauptthema: Die Liebe zu den Armen als Prüfstein des Evangeliums und Herzstück christlicher Nachfolge.
- Erster offizieller Text von Papst Leo XIV – veröffentlicht am 9. Oktober 2025.
Struktur der Apostolischen Exhortation Dilexi te
EINLEITUNG (Nr. 1–3)
- Ausgangspunkt: „Ich habe dir meine Liebe zugewandt“ (Offb 3,9) – Christus spricht zu einer armen, bedrängten Gemeinde.
- Bezug zu Papst Franziskus’ Enzyklika Dilexit nos über die Liebe des Herzens Jesu.
- Leo XIV. übernimmt und vollendet ein von Franziskus vorbereitetes Projekt über die Liebe zu den Armen.
- Ziel: Erneuerung des Bewusstseins, dass die Liebe zu Christus untrennbar mit der Liebe zu den Armen verbunden ist.
KAPITEL I – EINIGE WESENTLICHE PUNKTE (Nr. 4–15)
Kleine Gesten, große Liebe
- Das Beispiel der Frau mit dem Salböl zeigt: kein Akt der Liebe wird vergessen.
- Wahre Nähe zu den Armen ist Offenbarung, nicht bloß Wohltätigkeit.
Der heilige Franziskus und der Schrei der Armen
- Franziskus als Beispiel radikaler Umkehr durch Begegnung mit dem Leidenden.
- Der „Schrei der Armen“ (Ex 3,7–10) ist Gottes eigener Ruf an die Kirche.
Vielgestaltigkeit der Armut
- Armut ist materiell, sozial, kulturell, spirituell – Ausdruck menschlicher Verletzlichkeit.
- Warnung vor Gleichgültigkeit, Konsumismus und dem Irrglauben einer „Meritokratie“.
Ideologische Vorurteile
- Kritik an Weltanschauungen, die Armut als persönliches Versagen sehen.
- Aufruf, das Evangelium gegen soziale Ungerechtigkeit zu lesen – ohne ideologische Verzerrung.
KAPITEL II – GOTT ERWÄHLT DIE ARMEN (Nr. 16–34)
Die Erwählung der Armen im Heilsplan Gottes
- Gott neigt sich den Schwachen zu; seine „Option für die Armen“ ist theologisch begründet.
- Diese Option bedeutet keine Ausgrenzung anderer, sondern Nachfolge der göttlichen Barmherzigkeit.
Jesus, der arme Messias
- Christus lebt radikale Armut: Krippe, Heimatlosigkeit, Kreuz.
- Seine Armut ist Zeichen vollkommener Liebe.
Die Armen in der Heiligen Schrift
- Altes und Neues Testament zeigen: Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten sind untrennbar.
- Werke der Barmherzigkeit (Mt 25) sind Prüfstein des Glaubens.
- Frühchristliche Gemeinden lebten solidarische Gütergemeinschaft (Apg 6, Jak 2).
KAPITEL III – EINE KIRCHE FÜR DIE ARMEN (Nr. 35–62)
Der wahre Reichtum der Kirche
- „Eine arme Kirche für die Armen“ – Wunsch Franziskus’, übernommen von Leo XIV.
- Diakone wie Laurentius und Stephanus als Vorbilder: der Dienst an den Armen ist der Schatz der Kirche.
Die Kirchenväter und die Armen
- Ignatius von Antiochien, Polykarp, Chrysostomus, Augustinus:
- Nächstenliebe ist Ausdruck des Glaubens.
- Eucharistie und Sorge für die Armen gehören zusammen.
- Besitz ist Gabe Gottes zum Teilen, nicht zum Horten.
Die Sorge für die Kranken und Gefangenen
- Von Cyprian bis zu Johannes von Gott und Kamillus von Lellis:
- Heilung und Pflege als Werk des Glaubens.
- Liebe zu den Kranken als Begegnung mit Christus.
- Trinitarier und Mercedarier: Beispiel tätiger Liebe durch Befreiung der Gefangenen.
Die monastische Tradition
- Basilius, Benedikt und die Klöster: Orte des Gebets und des sozialen Dienstes.
- Gastfreundschaft, Arbeit, Bildung und Solidarität als Ausdruck der Liebe Christi.
KAPITEL IV – EINE GESCHICHTE, DIE WEITERGEHT (Nr. 63–94)
- Überblick über die kirchliche Tradition sozialer Lehre seit Rerum novarum (1891).
- Entwicklung der katholischen Sozialverkündigung bis Fratelli tutti.
- Erinnerung an Heilige und Gestalten der Neuzeit (Vinzenz von Paul, Mutter Teresa, Dulce dos Pobres).
- Verbindung von Spiritualität und sozialer Verantwortung.
- Aufruf zur „pastoralen Umkehr“: Die Kirche muss lernen, „von den Armen zu hören“.
KAPITEL V – EINE UNAUSWEICHLICHE HERAUSFORDERUNG (Nr. 95–118)
Die Armen als Subjekte, nicht Objekte
- Armenpastoral heißt nicht Almosen verteilen, sondern Teilhabe ermöglichen.
- Arme besitzen eine eigene Spiritualität, Weisheit und Berufung.
Globale Verantwortung und Hoffnung
- Aufruf zu strukturellen Veränderungen – ökonomisch, politisch, kirchlich.
- Kritik an globaler Ungleichheit und Ausbeutung.
- Glaube muss sich in sozialer Gerechtigkeit bewähren.
Schlussappell
- Kirche ist glaubwürdig nur, wenn sie an der Seite der Armen steht.
- „Die Liebe Christi drängt uns“ (2 Kor 5,14) – sie muss sichtbar werden in einer solidarischen Welt.
Kommentar von FJ Klausdeinken
Zwischen Anspruch und Wiederholung – Papst Leo XIV. und die Armenliebe
Mit Dilexi te legt Papst Leo XIV. sein erstes offizielles Lehrschreiben vor – ein Dokument, das programmatisch die Liebe zu den Armen ins Zentrum rückt. Schon der Titel, „Ich habe dich geliebt“, signalisiert die Richtung: Die Kirche soll in den Armen das Antlitz Christi erkennen und ihre Identität aus der Zuwendung zu den Schwachen neu gewinnen.
92. Es ist daher notwendig, weiterhin die »Diktatur einer Wirtschaft, die tötet« anzuprangern und anzuerkennen, dass »während die Einkommen einiger weniger exponentiell steigen, […] die der Mehrheit immer weiter entfernt [sind] vom Wohlstand dieser glücklichen Minderheit. Papst Leo
Das klingt vertraut. Und das ist es auch. Wer die Texte von Papst Franziskus gelesen hat – Evangelii Gaudium, Fratelli tutti oder Laudato si’ – findet hier kaum Neues. Leo XIV. knüpft eng an die Sozial- und Pastoraltheologie seines Vorgängers an. Die „Option für die Armen“ bleibt das Leitmotiv. Neu ist vor allem der Ton: etwas nüchterner, weniger prophetisch-poetisch, mehr seelsorglich und kirchlich-konservativ verankert.
Inhaltlich bleibt das Schreiben breit angelegt. Es benennt strukturelle Ungerechtigkeit, mahnt zum Umdenken und ruft zu Solidarität auf. Kleine Gesten der Nächstenliebe werden ebenso gewürdigt wie politische Verantwortung. Doch die entscheidende Frage bleibt offen: Wie wird aus dieser schönen Sprache kirchliches Handeln?
Gerade hier bleibt Dilexi te vage. Leo XIV. kritisiert eine „Seelsorge der Eliten“, die sich zu sehr um Einflussreiche bemüht, und fordert eine „Kirche mit den Armen“. Aber er vermeidet konkrete Reformforderungen. Was bedeutet das für die vatikanische Diplomatie, für kirchliche Finanzen oder für den Lebensstil von Klerus und Bischöfen? Dazu schweigt der Text.
Die theologische Grundlinie ist solide und biblisch fundiert – doch der Sprung von der moralischen Appellrhetorik zur strukturellen Veränderung gelingt nicht. Wer heute von sozialer Gerechtigkeit spricht, muss auch von Macht, Besitz, und Systemfragen sprechen. Genau das tut Leo XIV. nur andeutungsweise.
So wirkt Dilexi te wie ein Brückenschlag – zwischen der franziskanischen Radikalität seines Vorgängers und einer Kirche, die nach Orientierung sucht. Aber vielleicht braucht es in einer Welt wachsender Ungleichheit weniger Brücken und mehr Mut zur Konfrontation.
Die Armen stehen – wie so oft – im Mittelpunkt kirchlicher Worte. Jetzt bleibt zu zeigen, ob sie auch im Mittelpunkt kirchlichen Handelns stehen werden.