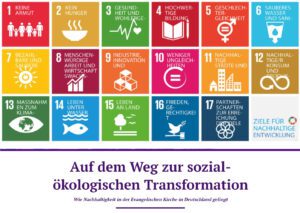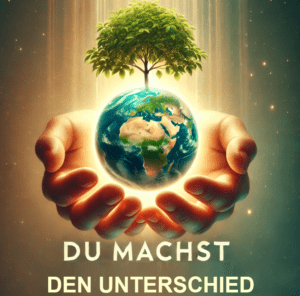Editorial in NATURE: Powerful people – Pope Francis und ein Interview mit dem Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und Berater des Vatikans
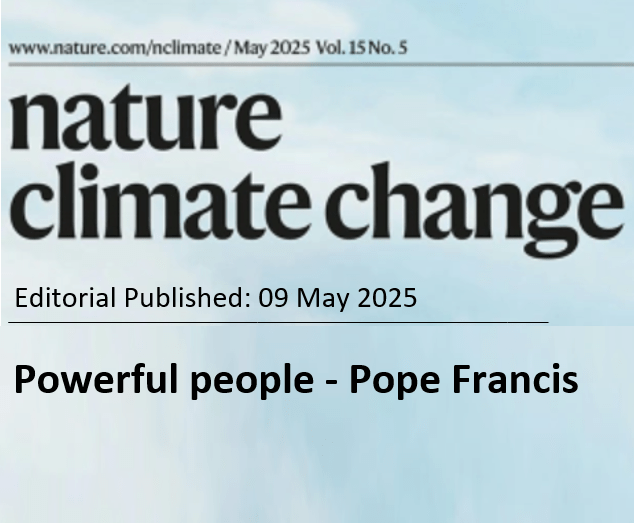
Powerful people – Pope Francis
Many voices are needed in the climate change discussion to reach across society. Pope Francis is one example who offered his voice and support, in the conversation that needs to continue.
In der Klimadiskussion braucht es viele Stimmen, um die gesamte Gesellschaft zu erreichen. Papst Franziskus ist ein Beispiel dafür, wie er seine Stimme und Unterstützung in diesem Dialog einbrachte, der fortgesetzt werden muss.
Die Enzyklika „Laudato Si’“ aus dem Jahr 2015 – über die Sorge um unser gemeinsames Haus – brachte Papst Franziskus‘ Hoffnung klar zum Ausdruck, dass die Gesellschaft zusammenarbeiten und sich als moralische Verpflichtung für den Umweltschutz einsetzen könne. Sie stellte die Wissenschaft in den Mittelpunkt, verknüpfte die Gesellschaft mit Umweltfragen und forderte die katholische Kirche auf, sich am Klimawandeldialog zu beteiligen. Die im Juni 2015 veröffentlichte Enzyklika trug zur Debatte bei, die zur Klimakonferenz der Vertragsparteien (COP) in Paris führte, die zum Pariser Abkommen führte, und war eine zeitgemäße Erklärung eines wichtigen Politikers.
Die Leidenschaft des Papstes für soziale Gerechtigkeit und Fairness sowie für Ökologie und Umwelt war so groß, dass er sich weiterhin für dieses Thema einsetzte und darüber aufklärte. 2019 erklärte er den Klimanotstand, forderte besseren Schutz für die Armen, forderte einen gerechten Übergang und verpflichtete die Kirche zum Klimaschutz.
Der Enzyklika folgte ein zweites veröffentlichtes Werk, Laudate Deum, ein apostolisches Schreiben aus dem Jahr 2023, das zu stärkerem Handeln aufrief und erklärte: „Im Laufe der Zeit habe ich erkannt, dass unsere Reaktionen unzureichend waren, während die Welt, in der wir leben, zusammenbricht und sich dem Zusammenbruch nähern könnte.“ Dies spiegelt seine vier Jahre zuvor geäußerten Aussagen zum Klimanotstand wider.
Die Enzyklika von 2015 fand damals breite Zustimmung, und nach ihrer Veröffentlichung präsentierte Nature Climate Change eine Reihe von Kommentarartikeln verschiedener Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die im Oktober 2015 erschienen waren und sowohl zentrale Fragen als auch Bereiche behandelten, die in der Enzyklika nicht behandelt wurden.
Die Literatur, die sich mit den Auswirkungen der Enzyklika befasst, zeichnet ein komplexes Bild. So ergab beispielsweise eine Studie, die die Einstellungen zum Klimawandel und zum Papst nach der Veröffentlichung der Enzyklika in den USA untersuchte, dass diejenigen, die die Enzyklika kannten, polarisiertere Ansichten zum Klimawandel hatten als diejenigen, die nichts davon wussten, und dass konservative Katholiken durch die gegensätzlichen Aussagen ihrer politischen Partei und denen des Papstes in einen Konflikt gerieten.1 Dieser Meinungskonflikt verdeutlicht die Schwierigkeit, polarisierende Themen zu kommunizieren.
Eine Studie in 18 lateinamerikanischen Ländern, die auf Umfrageergebnissen aus dem Jahr 2017 basiert, kam zu dem Schluss, dass sich regionale Diözesen am Diskurs über Umweltfragen beteiligen sollten, anstatt dem Aufruf des Papstes zu folgen, Klimaschutzmaßnahmen zu fördern, da Katholiken weniger wahrscheinlich an den vom Menschen verursachten Klimawandel glauben als Menschen ohne oder mit einer anderen Konfession.2
Beide Beispiele zeigen, dass sich einzelne Meinungen nicht so leicht beeinflussen lassen. Eine weitere Studie aus dem Jahr 2019 stellte fest, dass die Umsetzung eines Nachhaltigkeitsplans durch die Kirche einen positiven Effekt auf die Steigerung des Umweltbewusstseins und -engagements hatte. Dieses Ergebnis basiert auf Internet-Suchdaten, die zeigen, dass das öffentliche Interesse an der Umwelt zu wachsen scheint.3 Doch mittlerweile sind zehn Jahre vergangen, und obwohl wir die Auswirkungen der Enzyklika des Papstes nicht quantifizieren können, sind die Auswirkungen des Klimawandels weltweit spürbar. Das Thema Klimawandel polarisiert nach wie vor, und Fehl- und Desinformation nehmen Raum ein und schüren Ängste. Es ist wichtig, dass unterstützende Stimmen präsent sind, um diesem Lärm entgegenzuwirken. Der diesjährige Tag der Erde am 22. April stand unter dem Motto „Unsere Kraft, unser Planet“ – das Motto zielte darauf ab, Menschen im Kampf um erneuerbare Energien zu vereinen und die Energiewende zu unterstützen. Doch auch die Worte, so wie sie geschrieben sind, vermitteln eine starke Botschaft. Sie stehen im Einklang mit den Botschaften von Papst Franziskus in der Enzyklika und seinen darauffolgenden Mitteilungen, sich am Dialog zu beteiligen. Wir sollten die Macht des Kollektivs nicht vergessen – gewählte und ernannte Führungspersönlichkeiten können sich für oder gegen Klimaschutzmaßnahmen aussprechen, aber die Bevölkerung hat die Macht, sich zu beteiligen und Veränderungen herbeizuführen.
Übersetzt mit Google-Translator
Originalartikel in englisch auf www.nature.com (Link)
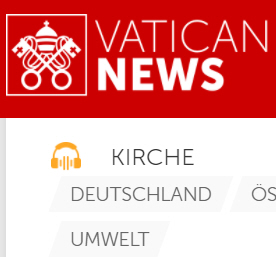
Interview mit Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und Berater des Vatikans
Der Artikel „10 Jahre Laudato sì: Umwelt als ‚Gemeinschaftsgut‘“ auf Vatican News beleuchtet das zehnjährige Jubiläum der Umweltenzyklika Laudato si’ von Papst Franziskus und deren anhaltende Bedeutung für Umwelt- und Sozialpolitik.
Im Mittelpunkt steht ein Interview mit dem Klimaforscher Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und Berater des Vatikans. Edenhofer betont, dass die Atmosphäre als „Gemeinschaftsgut“ betrachtet werden müsse, das gerecht und nachhaltig bewirtschaftet werden sollte. Diese Perspektive sei ein zentraler Gedanke der katholischen Soziallehre, der stärker in das öffentliche Bewusstsein rücken müsse.
Edenhofer hebt hervor, dass Laudato si’ nicht nur eine Umweltenzyklika sei, sondern auch soziale Aspekte betone. Sie rufe zu einer ganzheitlichen Ökologie auf, die ökologische, soziale und ökonomische Dimensionen miteinander verknüpft. Besonders in Zeiten globaler Herausforderungen wie dem Klimawandel sei diese integrative Sichtweise von großer Bedeutung.
Der Artikel verweist zudem auf die Rolle des neuen Papstes Leo XIV., der die Anliegen von Laudato si’ fortführen möchte. Es wird betont, dass die Kirche weiterhin eine wichtige Stimme im globalen Diskurs über Umwelt- und Sozialfragen sein sollte.
Auch die wissenschaftliche Gemeinschaft würdigt die Bedeutung von Laudato si’. In einem Editorial der Fachzeitschrift Nature Climate Change wird die Enzyklika als bedeutender Beitrag zur Klimadebatte hervorgehoben. Das Editorial betont, dass Papst Franziskus mit Laudato si’ die Umweltfrage als moralisches Anliegen in den Mittelpunkt gerückt und die katholische Kirche zur aktiven Teilnahme am Klimadialog aufgerufen habe. Die Enzyklika habe damit auch zur Vorbereitung der Klimakonferenz in Paris 2015 beigetragen, die im Pariser Klimaabkommen mündete. Nature
Insgesamt unterstreicht der Artikel die Relevanz von Laudato si’ auch zehn Jahre nach ihrer Veröffentlichung und ruft dazu auf, die Enzyklika als Impuls für eine gerechtere und nachhaltigere Welt ernst zu nehmen.
Den Artikel lesen auf Vatican News (Link)