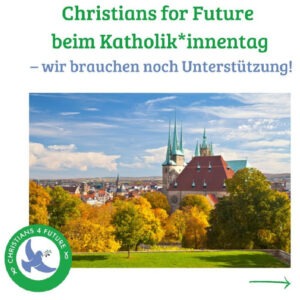Sozialethische Zwischenrufe zur Bundestagswahl von FJ Klausdeinken
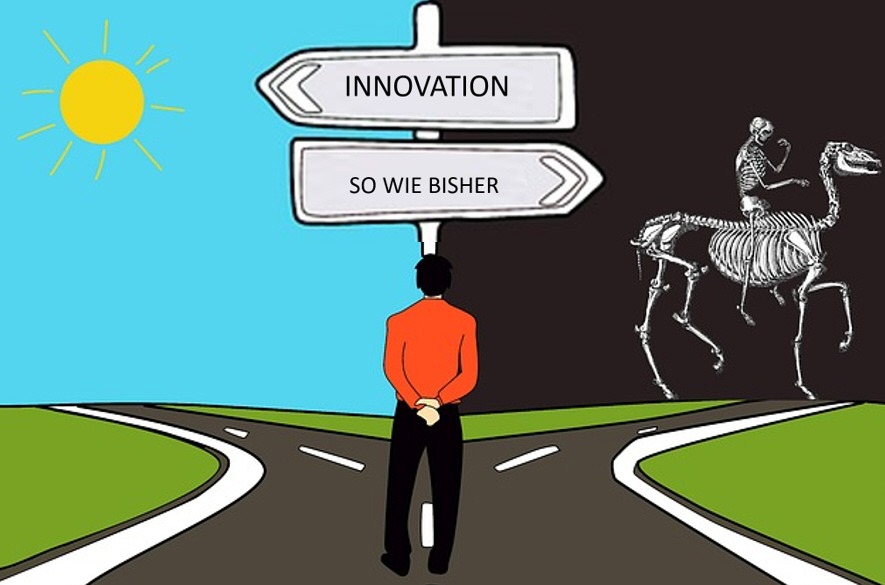
Innovation vs. So wie bisher
6,2 Prozent aller Erwerbstätigen in NRW arbeiten in der Umweltwirtschaft
Die Umweltwirtschaft in Nordrhein-Westfalen hat sich in den letzten Jahren als treibende Kraft für ökologischen Fortschritt und wirtschaftliche Stabilität erwiesen. Laut dem Umweltwirtschaftsbericht 2024 arbeiten in dieser Branche rund 600.000 Menschen, was etwa 6,2 Prozent aller Erwerbstätigen in NRW entspricht. Die jährliche Bruttowertschöpfung stieg zwischen 2020 und 2023 um 9,2 Milliarden Euro, und die Anzahl der Erwerbstätigen erhöhte sich um jährlich 21.600 Personen. Diese positive Entwicklung unterstreicht die Bedeutung der Umweltwirtschaft als krisenfeste und zukunftssichere Branche.
Ein wesentlicher Aspekt dieses Erfolgs ist die sogenannte „ökologische Dividende“. Durch die Vermeidung von Umweltschäden und die Schaffung ökologischer Werte, wie den Erhalt der Biodiversität, erzielt die Umweltwirtschaft in NRW einen ökologischen Nutzen von rund 28,9 Milliarden Euro. Zudem trägt sie durch ihre Produkte und Dienstleistungen zur Einsparung von etwa 63 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalenten bei.
Kirchliche Institutionen zunehmend nachhaltig unterwegs
Auch kirchliche Institutionen engagieren sich zunehmend für Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Die Diakonie Deutschland hat das Ziel, bis 2035 klimaneutral zu wirtschaften, und plant hierfür Investitionen in Milliardenhöhe in Gebäude und Prozesse. Eine Studie schätzt den Investitionsbedarf für ein durchschnittliches Pflegeheim auf 1,8 Millionen Euro. Insgesamt sind für die gesamte Sozialwirtschaft (ohne den Krankenhausbereich) Investitionen von mindestens 65 Milliarden Euro erforderlich, um die Klimaneutralität bis 2035 zu erreichen. ekd.de
Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat bereits frühzeitig die Bedeutung einer nachhaltigen Entwicklung erkannt. Mit der Agenda 2030 und den darin enthaltenen 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) haben die Vereinten Nationen einen globalen Rahmen geschaffen, den auch die Kirche aktiv unterstützt. Bereits 1975 forderte der Ökumenische Rat der Kirchen eine „gerechte, partizipative und nachhaltige Gesellschaft“ und legte damit den Grundstein für das heutige Engagement der Kirchen im Bereich Nachhaltigkeit.agu.ekd.de
Energieeffiziente Gebäudesanierung
Die Landeskirchen und Bistümer haben im Rahmen ihrer Klimaschutzkonzepte zahlreiche Maßnahmen zur energetischen Optimierung von Gebäuden definiert. Dazu gehören die Modernisierung der Gebäudehülle, die Optimierung von Heizungsanlagen und die Nutzung erneuerbarer Energien durch eigene Stromerzeugung. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, den Energieverbrauch zu senken und die CO₂-Emissionen deutlich zu reduzieren.
Ein Beispiel ist die Evangelische Landeskirche in Baden, die durch gezielte energetische Sanierungen bereits 29 % ihrer CO₂-Emissionen einsparen konnte. Der Fokus lag dabei auf der Verbesserung der Gebäudehülle, bevor weitere Effizienzpotenziale erschlossen wurden. daemmen-lohnt-sich.de
Förderung nachhaltiger Mobilität
Im Bereich der Mitarbeitermobilität setzen kirchliche Einrichtungen auf verschiedene Maßnahmen, um den CO₂-Ausstoß zu verringern. Dazu zählen die Einführung von Jobtickets, die Umstellung des Fuhrparks auf Elektrofahrzeuge und die Schaffung von Anreizen für umweltfreundliche Verkehrsmittel. Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat beispielsweise das Netzwerksprojekt „Mobilität & Kirche“ ins Leben gerufen, um nachhaltige Mobilitätskonzepte zu entwickeln und umzusetzen. agu.ekd.de
Appell: Die Kirche ist nicht nur eine moralische Instanz, sondern auch ein Motor für Nachhaltigkeit, Innovation und zukunftssichere Arbeitsplätze. Ihr Engagement zeigt, dass ökologischer Fortschritt und wirtschaftliche Stabilität Hand in Hand gehen können. Es liegt an uns allen, diesen Weg gemeinsam weiterzugehen und unsere Gesellschaft nachhaltig und gerecht zu gestalten.

Umweltwirtschaftsbericht 2024: Branche sorgt für ökologischen Nutzen in Milliardenhöhe
Der Schutz von Klima und Ressourcen sowie der Erhalt der Biodiversität sichern unseren Wohlstand und ein zukunftsfähiges Wirtschaftswachstum: Die Umweltwirtschaft ist eine Leitbranche, in der 2023 rund 600.000 Menschen in Nordrhein-Westfalen gearbeitet haben – Tendenz steigend. Das zeigt der am Donnerstag, 7. November 2024, veröffentlichte Umweltwirtschaftsbericht 2024 für Nordrhein-Westfalen, den die Prognos AG in Kooperation mit dem Institut für ökologische Wirtschaftsforschung im Auftrag des Umweltministeriums erstellt hat.
Umweltwirtschaft ist ökonomisches Schwergewicht
Wie sehr die „Green Economy“ zum neuen Motor der Wirtschaft des traditionell geprägten Industrielands geworden ist, veranschaulichen die vorgelegten Zahlen. Mit 6,2 Prozent der Erwerbstätigen in Nordrhein-Westfalen beschäftigt die Branche inzwischen mehr Menschen als die Metallindustrie und der Maschinenbau zusammen.
Überdurchschnittliches Wachstum in Krisenzeiten
Die Umweltwirtschaft hat sich in Nordrhein-Westfalen sowohl während der Corona-Pandemie als auch in den multiplen Krisen danach als krisenfest erwiesen und zur Stabilisierung der Volkswirtschaft beigetragen.
Innovation als Schlüssel zum Erfolg
Ihr Stellenwert als zukunftweisende Leitbranche beruht auf einer ausgeprägten Innovationsorientierung. Nordrhein-Westfalen zählt nach den USA und Japan zu den globalen Innovationsführern bei Patenten der Umweltwirtschaft. Auch im innerdeutschen Vergleich belegt Nordrhein-Westfalen Platz 3 hinter Bayern und Baden-Württemberg. Ein Innovationsschwerpunkt in Nordrhein-Westfalen bildet das Recycling von Batterien, Windenergie- und Photovoltaikanlagen.
Alle Details lesen auf www.land.nrw (url-Link)
Download des Umweltwirtschaftsbericht NRW 2024 (pdf, 112 Seiten, 19 MB)