Nachhaltigkeitsberichtserstattung der Dt. Bischofskonferenz

An der politischen Willensbildung mitwirken
Die Veränderungen der gesetzlichen, regulatorischen Rahmenbedingungen tangieren immer wieder kirchliche Positionen und Interessen. Da diese Veränderungen in die Souveränität der Organisationen eingreifen und sich auch auf finanzielle Spielräume auswirken können, ist es sicherlich verständlich und legitim, dass sich kirchliche Einrichtungen in politischen Diskussions- und Entscheidungsprozessen positionieren.
Für die Nachhaltigkeitsberichterstattung ist entscheidend, dass diese Positionen und das Engagement transparent sind. Dieses Kriterium richtet sich nicht nur an Einrichtungen, die selbst auf Landes- oder Bundesebene vorstellig werden, sondern auch kleinere und mittlere Einrichtungen können ihre politischen Interessen vertreten: entweder direkt gegenüber der Kommunal- oder Landespolitik oder indirekt über Gemeinschaftsinitiativen und Verbände, die diesen in der Politik eine Stimme geben und an der politischen Willensbildung mitwirken.
Beispiele aus der Praxis
- Das (Erz-)Bistum nimmt durch sein Katholisches Büro und das Katholische Büro in Berlin unter strikter Einhaltung [partie-*] politischer Neutralität an politischen Diskursen teil. Im Folgenden werden unsere Aktivitäten und Richtlinien in Bezug auf politische Einflussnahme beleuchtet.
- Die Katholischen Büros sind wichtige Verbindungs- und Informationsstellen zwischen Kirche und Politik. Über die Büros treten Bischöfe mit Landesregierungen, Ministerien, Parteien und gesellschaftlichen Verbänden in Kontakt. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, auf den Gebieten der Politik, Gesellschaft sowie Gesetzgebung eine einheitliche Auffassung der katholischen Kirche nach außen darzustellen und zu vertreten.
- Die Vertretung einer einheitlichen Auffassung der katholischen Kirche in den landespolitischen Raum hinein geschieht z. B. durch Stellungnahmen bei Gesetzesanhörungen und durch Vorbereitung, Prüfung und Abschluss von Verträgen und Vereinbarungen. Außerdem finden regelmäßige Treffen, Hintergrundgespräche und Diskussionsforen zwischen Vertretern von Kirche und Landespolitik statt. Die Arbeit der Katholischen Büros soll so zu einem dialogischen und vertrauensvollen Verhältnis zwischen Staat und Kirche beitragen. Die Themenfelder sind überaus vielfältig: Das gesamte Unterrichts- und Bildungswesen vom Kindergarten bis zur Universität gehört ebenso dazu wie die Bewahrung und Weiterentwicklung der kategorialen Seelsorge, z. B. in den Justizvollzugsanstalten und bei der Polizei. Auch die familien- und sozialpolitischen gemeinsamen Aufgaben von Staat und Kirche, z. B. im Bereich der Beratungsstellen, sind Gegenstand der Arbeit.
- Das (Erz-)Bistum übt darüber hinaus keinen unmittelbaren Einfluss auf Gesetzgebungs- und Verordnungsverfahren aus. Eigene Kriterien für politisches Engagement außerhalb des genannten Rahmens bestehen nicht, was sicherstellt, dass seine Aktivitäten konsistent mit den gemeinsamen Zielen und Interessen der katholischen Kirche sind.
- Daneben werden seine Interessen durch die Deutsche Bischofskonferenz und Mitgliedschaften in einzelnen Organisationen und Verbänden vertreten.
Relevanter GRI Indikator für (Erz-)Bistümer GRI SRS-415-1 (Global Reporting Initiative)
* Wortergänzung, s.u. Anmerkung 5)
Quelle: Orientierungshilfe zur Nachhaltigkeitsberichtserstattung der DBK, S. 98 ff
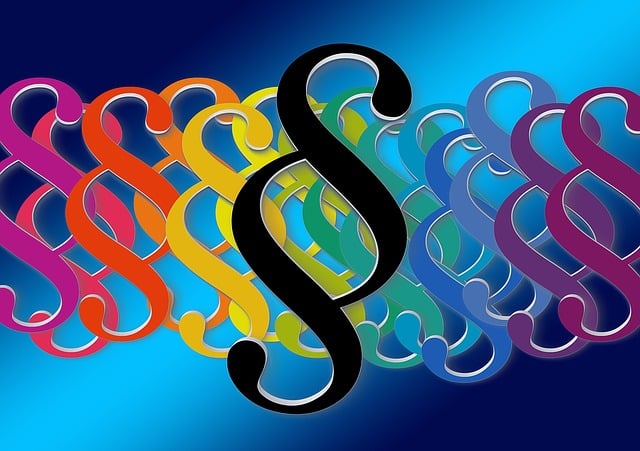
Rechtliche Rahmenbedingungen der politischen Betätigung von gemeinnützigen Organisationen
In das Bewußsein der breiten Öffentlichkeit ist das Thema „politische Betätigung gemeinnütziger Organisationen“ seit den Entscheidungen des Bundesfinanzhofs am 10. Januar 2019 (Az.: V R 60/17) und 10. Dezember 2020 (Az.: V R 14/20) zur Gemeinnützigkeit von attac, einer globalisierungskritischen Nichtregierungsorganisation, gerückt. In diesem Zusammenhang ist auch die frühere Entscheidung des Bundesfinanzhofs zum BUND e. V. vom 20. März 2017 (Az.: X R 13/15) von großer Bedeutung.
Die isolierte Verfolgung parteipolitischer Zwecke gemeinnützigen Organisationen ist nach ständiger Rechtsprechung und der überwiegenden Meinung im Schrifttum der geltenden Rechtslage verboten.
Politische Betätigung ist gemeinnützigen Organisationen aber dann gemeinnützigkeitsrechtlich erlaubt, wenn die politische Betätigung dem satzungsgemäßen Zweck dient.3) Diesen Grundsatz hat der Bundesfinanzhof in seinen Entscheidungen zu attac ausdrücklich betont.4) Eine gemeinnützige Körperschaft darf also auf die politische Willensbildung und die öffentliche Meinung Einfluss nehmen, wenn dies der Verfolgung einer der Zwecke aus § 52 Abs. 2 AO dient. Die Beschäftigung mit politischen Vorgängen muss im Rahmen dessen liegen, was das Eintreten für die steuerbegünstigten Ziele und deren Verwirklichung erfordert. Im Rahmen der erlaubten politischen Betätigung muss sich die Organisation „parteipolitisch neutral“ verhalten.5) Die politische Einflussnahme darf die anderen Tätigkeiten nicht „weit überwiegen“.
3) Weitemeyer, npoR 2019, 97 (104)
4) BFH vom 10.01.2019 Az. V R 60/17 Rn. 16 und BFH vom 10.12.2020, Az. V R 14/20 Rn. 12.
5) BFH vom 10.01.2019 Az. V R 60/17 Rn. 22.
Auszug aus einem Gutachten des Paritätischen Gesamtverbands (pdf, 6 Seiten)
Politische Betätigung und Gemeinnützigkeit
BFH vom 10.01.2019 Az. V R 60/17 Rn. 22.
1. Wer politische Zwecke durch Einflussnahme auf politische Willensbildung und Gestaltung der öffentlichen Meinung verfolgt, erfüllt keinen gemeinnützigen Zweck i.S. von § 52 AO. Eine gemeinnützige Körperschaft darf sich in dieser Weise nur betätigen, wenn dies der Verfolgung eines der in § 52 Abs. 2 AO ausdrücklich genannten Zwecke dient.
2. Bei der Förderung der Volksbildung i.S. von § 52 Abs. 2 Nr. 7 AO hat sich die Einflussnahme auf die politische Willensbildung und Gestaltung der öffentlichen Meinung auf bildungspolitische Fragestellungen zu beschränken.
3. Politische Bildung vollzieht sich in geistiger Offenheit. Sie ist nicht förderbar, wenn sie eingesetzt wird, um die politische Willensbildung und die öffentliche Meinung im Sinne eigener Auffassungen zu beeinflussen.
4. Bei der Prüfung der Ausschließlichkeit der steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zweckverfolgung und der tatsächlichen Geschäftsführung nach §§ 56, 63 AO kann zwischen der Körperschaft als „Träger“ eines „Netzwerks“ und den Tätigkeiten des unter dem gleichen Namen auftretenden „Netzwerks“ zu unterscheiden sein. Dabei sind alle Umstände einschließlich des Internetauftritts der Körperschaft zu berücksichtigen.
Quelle: openjur.de


